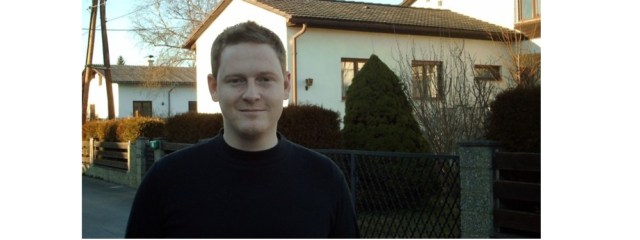[1] Wenn man derzeit die Diskurse zur Lage der Europäischen Union, europäisch und global betrachtet, ist das Wort der „Krise“, bedeutend „Desintegration“, „Zerfallen“, also beinahe ins Assoziationsfeld von „Scheitern“ hineinspielend, das Entscheidende. Wolfgang Schmale hat vor kurzem in diesem Blog die Frage aufgeworfen, welche Krisendiagnose denn nun eigentlich die zutreffende sei.
[2] Als Kultur- und Zeithistoriker, der sich seit längerer Zeit mit der Geschichte der europäischen Integration nach 1945, vor allem ihren theoretischen und diskursiven Grundlagen als einer Form eines Erzählens von und über Europa beschäftigt, drängt sich dazu eine spezifische Sicht auf: Nämliche jene, dass die Entscheidung Angela Merkels vom 5. September 2015, in der „Migrationskrise“ die bundesdeutschen Grenzen zu öffnen, ein entscheidendes Ereignis war; eines, das sich über das Instrumentarium der kulturgeschichtlichen Erzähltheorie im Anschluss an Hayden White besser begreifen lässt.
[3] Merkels Entscheidung markierte ein historisches Zäsurereignis, das die Qualität der schon bestehenden „Krise“ Union veränderte: Man kann den 5. September 2016 als historisches Ereignis lesen, das für die EU bis heute den Beginn einer tiefen „Kohärenzkrise“ bedeutete – die Unübersichtlichkeit und auch das politische Lavieren zwischen „Wir schaffen das!“ und „Festung Europa“ machen es unmöglich, die EU als historisches Subjekt zu lesen.
[4] Ihr Identitätstext, vorher schon in seiner Kohärenz gefährdet, stand vor dieser Zäsur noch immer für ein gewisses Maß an Vorteilen (Grenzlosigkeit vor allem im Schengen-Raum; Frieden, wenn auch längst zur Historie geworden; gewisse soziale Gemeinsamkeiten der Gesellschaften der EU; der Binnenmarkt; der Euro), die die EU zum geteilten Identitätssubjekt der BürgerInnen machen konnten.
[5] Durch die aktuelle Zeitgeschichte der EU seit dem September 2015 hat sich das dramatisch verändert. Durch den wiederkehrenden Terror in der EU, durch das mehr als labile Hadern und Lavieren der führenden PolitikerInnen der EU in Fragen der Grenz-, Asyl-, Migrations- und Sicherheitspolitik (wobei hier natürlich dem Handeln der Personen durch die Strukturen der EU Grenzen gesetzt sind) wurde die Kohärenz des EU-Identitätstexts vollkommen erschüttert: Als historisches Subjekt ist sie in den Augen vieler BürgerInnen in keiner Weise mehr ein identifikationswürdiges Objekt, das Kohärenz ausstrahlt; ihr Narrativ ist vielmehr in sich gebrochen, fragil, krisenhaft, es ist unlesbar geworden. Kurz: die EU befindet sich seit Herbst 2015 in einer „Kohärenzkrise“.
[6] Um diese Situation besser einschätzen zu können, ist nicht nur eine politische Bestandsaufnahme der Entscheidungen vonnöten, sondern auch eine kulturgeschichtliche Reflexion, die mit ihren Erkenntnisinstrumenten zu einem besseren Verständnis und damit zum Aufzeigen von aktuellen Handlungsressourcen beitragen kann.
[7] Das Werk des US-amerikanischen Geschichtstheoretikers Hayden White (geb. 1928), vor allem sein „Opus magnum“ „Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa“ (zuerst englisch 1973, dann deutsch 1991), wurde kontrovers diskutiert. Seine Hauptthese, dass die Geschichtsschreibung „mehr Kunst als Wissenschaft“, „Protowissenschaft“ und vor allem ein „literarisches Artefakt“ des Diskurses sei, wurde breit rezipiert, diskutiert, in Frage gestellt; aber auch teils wohlwollend angenommen, noch weiter differenziert und sowohl empirisch als auch theoretisch überprüft. Wir können es so zusammenfassen, dass heute das Faktum, dass die Geschichte immer auch ein Erkenntnisinstrument in Erzählungsform ist, weitestgehend akzeptiert ist.
[8] Wenn wir nun zu White und seiner „Poetik der Geschichte“ zurückgehen, können wir ein besseres Verständnis für das letzte Jahr unionseuropäischer Zeitgeschichte gewinnen. Am Wochenende des 4., 5. und 6. September 2015, angesichts dramatischer Eindrücke in anderen EU-Staaten wurde die drei Tage zu „Merkels Mauerfall“. Eine enorme Migrationsbewegung setzt sich in Bewegung. In den Medien erscheint die EU seither, gefangen in Hadern, Diskussion und ambivalentem Management der Situation endgültig nicht mehr als handelndes Subjekt der Identifikation. Die positive Identifikation mit ihr, stehend für die oben genannten positiven Werte, zerbricht endgültig auf breiter Front. Die Kohärenz ihrer Identität zerbricht endgültig, und dies ist die Situation bis dato.
[9] Ein Schlüsselaspekt des Verstehens des letzten Jahres kann in einer Re-Lektüre von Whites Metahistory liegen, nämlich in seiner Theorie historischer Erzählformen. Nach White lassen sich die möglichen Arten, Geschichte zu erzählen, in vier „Tropen“ zusammenfassen: nämlich „Metapher“, „Metonymie“, „Synekdoche“ und „Ironie“. Als Formen der geschichtlichen Erzählungen kennzeichnet er die Metapher als darstellend, die Metonymie als reduktionistisch, die Synekdoche als integrativ und die Ironie als negatorisch.
[10] Der entscheidende Aspekt für unsere Gegenwart in Whites Buch liegt nun darin, wie er die Entwicklung der europäischen Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert als Abfolge der Erzählformen ausarbeitet: Ihm zufolge war das Jahrhundert zwischen den AufklärerInnen, den VorromantikerInnen, dann den RomantikerInnen und IdealistInnen, den HistoristInnen und schließlich eigenwilligen DenkerInnen wie Nietzsche oder Marx, eine Abfolge eines Prozesses, der von der konstruktiven Metapher und Metonymie, über die integrative Synekdoche hin zur Ironie (vor allem dann auch bei Nietzsche) führte.
[11] Dies ist der entscheidende Denkschritt: White erkannte, dass Krisen der Gegenwartsdeutung (in dem Fall die Krise des Historismus) mit einer veränderten Erzählweise der Geschichte einhergehen: nämlich mit jener der Ironie, ihrer Distanz zum Subjekt der Geschichte, ihrem Spott in ihrem beißenden Duktus, der die Kohärenz zerstört. Die schärfste Form dessen ist die Satire.
[12] Wenn wir nun ans unser zeitgeschichtliches Bild der EU seit „Merkels Mauerfall“ blicken, können wir klare Ähnlichkeiten erkennen. Schon bis zu diesem Wochenende im frühen Herbst 2015 war die Erzählweise in den Medien und auch der Wissenschaft über die Union verändert, nämlich ernüchtert, distanziert, kritisch und auch etwas hoffnungslos. Seit der Europa-Euphorie der 1950er-Jahre mit produktiven historischen Metaphern („Haus Europa“, „Europa vom Atlantik bis zum Ural“, „Europa der Regionen“ usw.), war immer ein zumindest notwendiges Maß der Kohärenz der Erzählungen der EU als Geschichte gegeben gewesen. Die Metaphern hielten im Diskurs über die EU ihre Identität positiv am Leben. Dies war die Erzählweise der Metapher bis zu jenem Herbst.
[13] Mit „Merkels Mauerfall“ (also einem nationalen Ereignis europäischen Zuschnitts) änderte sich die Erzählweise: Über die EU wurde nun noch viel kritischer, distanzierter, identitätsloser und verzerrender, kurz ironisch und satirisch erzählt. Die Identität der EU hat ihre historische Kohärenz verloren, sie war von „Haus Europa“ zu einer Karikatur, entworfen im satirischen Duktus von Ohnmacht und Kontrollverlust, geworden. Sie hatte ihre Kohärenz verloren, kaum jemand von den europäischen BürgerInnen will sich mit einer ironisierten Figur einer zeitgeschichtlichen Satire identifizieren.
[14] Was bedeutet das nun? Wir können mit Hayden Whites Erkenntnisraster die Zeitgeschichte Europas in kulturgeschichtlicher Hinsicht, in Bezug auf Identität und Kohärenz des Images der EU, europäisch und global, besser deuten. Was mit Merkels Entscheidung begann, kann so sehr prägnant als ein „Sturz der EU in die Satire“ bezeichnet werden. Seit „Merkels Mauerfall“ (schon die Referenz auf 1989 ist in sich satirisch) wurde die EU im medialen und kulturellen Bild bei den BürgerInnen zu einem fast hoffnungslosen Fall, der für Handlungslosigkeit, Widersprüche und Scheitern, kurz für Inkohärenz steht.
[15] Wenn wir nun die gegenwärtige Situation der EU kulturgeschichtlich als „Kohärenzkrise“ deuten, die satirischen und ironischen Stellungnahmen als einen „Ruf nach Kohärenz“ sehen, kann die Politik neue Handlungsressourcen abstecken. Diese bestehen nämlich darin, frontal eben jenes satirische Bild Europas anzugehen, über konstruktive und produktive Erzählweisen (etwa vor allem bei den vielbeachteten Gipfeln) ganz bewusst den Bildcharakter der EU wieder zu verändern. Strukturell sind dazu genau jene Punkte von Bedeutung, die auch Wolfgang Schmale anführte: die Einführung eines europäischen Referendums, europäische Parteien und Öffentlichkeit, beginnend bei einer Reform des Europawahlrechts.
Dokumentation:
Peter Pichler: EUropa. Was die Europäische Union ist, was sie nicht ist und was sie einmal werden könnte. Mit einem Vorwort von Erhard Busek. Graz 2016.
Hayden White: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt/Main 1991. [englisch zuerst 1973]
CV Dr. phil. Peter Pichler:
2001 – 2006 Studium der Geschichte; Medien und Philosophie in Graz und Mainz; 2009 Promotion in Zeitgeschichte in Graz; Arbeitsschwerpunkte in der Kulturgeschichte der Europäischen Union, der Kulturgeschichte von Heavy Metal sowie der Philosophie und Theorie der Kulturgeschichte; 2004 – 2012 Lehrbeauftragter und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Rechtsgeschichte der Universität Graz; seit 2014 Publikations- und Forschungsprojekt zur Kulturgeschichte von Heavy Metal www.peter-pichler-stahl.at; zahlreiche internationale Publikationen und Vorträge in den genannten Bereichen.
Empfohlene Zitierweise (die Absätze sind in eckigen Klammern für Zitationszwecke nummeriert):
Peter Pichler: Die gegenwärtige „Krise“ der Europäischen Union: der Sturz in die Satire und der Ruf nach Kohärenz. In: Wolfgang Schmale: Blog „Mein Europa“ https://wolfgangschmale.eu/ gastbeitrag-peter-pichler-krise-der-europaeischen-union-der-sturz-in-die-satire-und-der-ruf-nach-kohaerenz [Absatz Nr.].